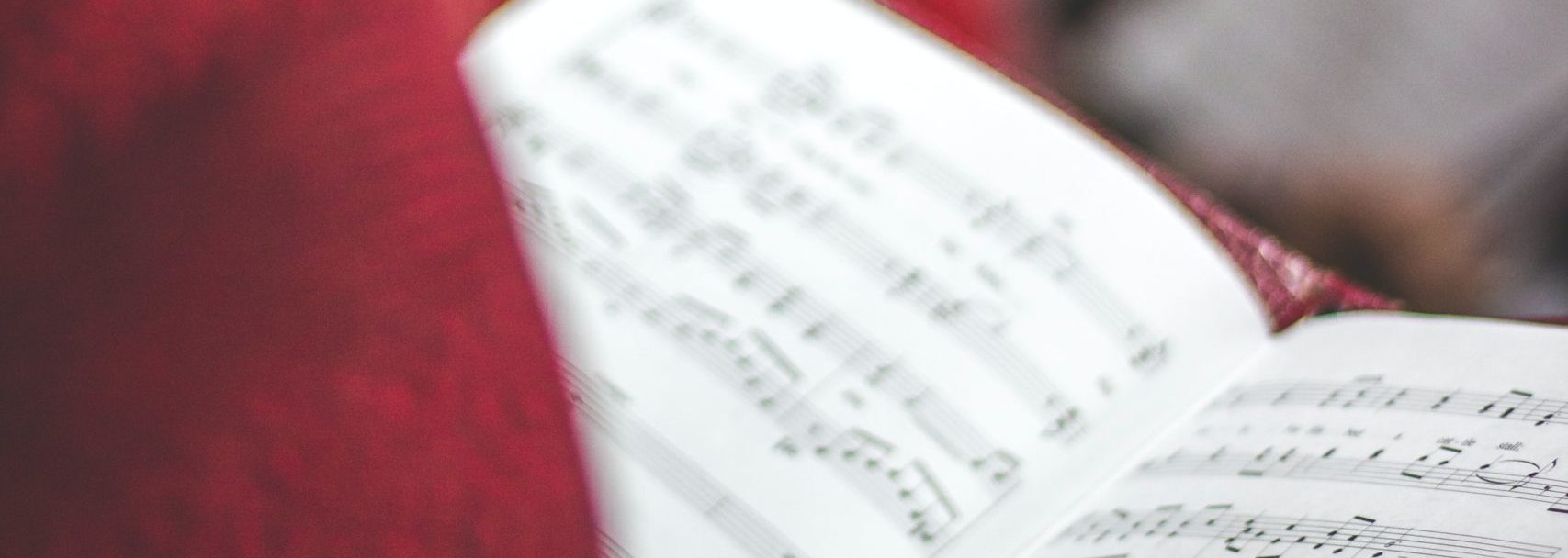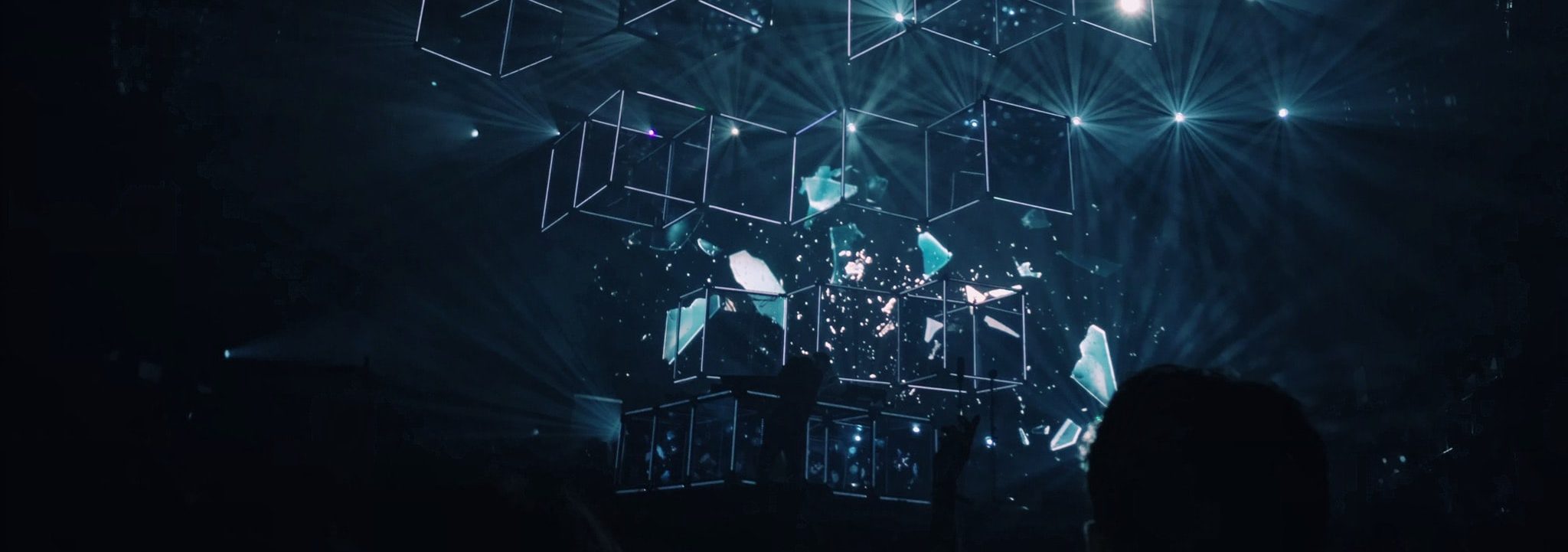Wir tragen jetzt Masken. Auf der Straße und in der Kirche. Aber ich bin im letzten Vierteljahr von so vielen Veränderungen überrollt worden, dass ich noch gar nicht die Zeit hatte, mich hinzusetzen und diesen Satz anzuschauen und zu überlegen, was das eigentlich mit mir macht. Und was da aus meinem Pop- und Bildgedächtnis mitschwingt. Und was das dann wiederum mit mir macht.
Wir tragen jetzt Masken.
Und offenbar retten uns die Masken. Das sagen zumindest gerade alle, nachdem das RKI erst gesagt hat, die bringen nichts. Jetzt bewahren uns die Masken vor der unbekannten aerosolen Gefahr in der Luft. Jedes Mal wenn ich jemanden mit Maske sehe, gehe ich extra weit um sie oder ihn herum. Dann springt dieser ganze Virenwahnsinn wieder in den Vordergrund meines Bewusstseins.
Horror Vacui Personae
Einige haben schon längst Masken in den liturgischen Farben gekauft oder genäht oder wahrscheinlich nähen lassen, andere haben Sprüche draufgedruckt: Du bist schön! Oder #gesegnet. Erstaunlich, dass ich noch keinen Nike-swoosh gesehen habe. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche hat ihre Kirchenfenster auf diese Stoffmasken drucken lassen. Sieht ein kleines bisschen aus wie Zähne von weitem. Von Nahem macht es den unteren Bereich des Gesichts zum Fenster. Nicht mehr die Augen sind das Fenster zur Welt, sondern die Maske. Nur die Maske ist geschlossen.
Ich finde gerade die einfache Wegwerf-OP-Maske ist wohl DAS Symbol für diese Pandemie. Ubiquitär. Klinisch-blau. Kapitalistisch: erst rar und überteuert, jetzt marktüberschwemmend. DAS gefragte Gut, DIE Eintrittskarte in Supermärkte, auch für mit den Security-Leuten wetternde Verschwörungsleute. Da macht es Sinn, dass Menschen auch damit kreativ umgehen. Und sie zum Ausdruck ihrer Persönlichkeit machen. Jugendliche haben schnell herausbekommen, wie man mit Maske entspannt, elegant und souverän auftreten kann. Brautaustatter brillieren weiße Masken mit Steinen und Perlen für das hygienisch sichere Ja-Wort.
Denn die Maske bringt Leere ins Gesicht und versteckt zwei Drittel von dem, was wir von Kindheit auf gelernt haben bewusst und unbewusst zu deuten an unserem Gegenüber. Sie entmenschlicht. Denn das Angesicht des Gegenübers, so hat das Immanuel Levinas, grob gesagt, entwickelt, stellt an uns einen transzendenten, unhintergehbaren ethischen Anspruch: Ich bin ein Mensch wie Du, Du musst Dich um mich kümmern. Nicht mehr mit der Maske. Die macht es handhabbar, die ist Erfüllungsgehilfe im Abstoßen und Wegdrängen des und der anderen.
Pop-Masken, eine kurze Genealogie der Entmenschlichung
Masken entmenschlichen. Darth Vader als böser Urvater braucht seine Fetischmaske als Beatmung und um seinen Rest Menschlichkeit zu verstecken. In der ultragewalttätigen Videospielserie Mortal-Combat trägt Sub-Zero eine Maske, offenbar, weil er nicht einfach normale Luft atmen kann. Genauso wie Darth Vader also. Michael Myers aus Halloween, Jason Vorhees aus Freitag der 13, Ghostface, Fantomas, Dr. Doom, der Joker am Anfang von The Dark Knight, der Winter Soldier aus Captain America und Boba Fett aus The Mandalorian und dem breiteren Star-Wars-Franchise – genauso wie alle Ninjas und Attentäter und Bankräuber wie die mit Präsidentenmasken aus Gefährliche Brandung – tragen Masken, weil sie schlicht nicht erkannt werden wollen.
Die Masken der Bösen bedecken das ganze Gesicht oder den Mund. Komischerweise tendieren die guten und die Superhelden dazu, dass sie den Mund freilassen. Die Ganz- oder Mund-Masken machen die Bösen mächtiger, unzugänglicher, mysteriöser und anonymer. Sie entkleiden sich der Menschlichkeit als Schwäche, indem sie ihr Gesicht bedecken. Aber eine Maske, finde ich, geht noch mehr in die Tiefe.
Keiner Interessierte sich dafür, wer ich war, bevor ich die Maske bekam.
Bane sagt das. Oder eigentlich Tom Hardy, in the Dark Knight Rises. Damit legt er eine Spur, die ich für ein paar theologische Überlegungen zur Maske hilfreich finde. Denn die Maske ist eine neue, andere Art, sich selbst zu verstehen, gesehen zu werden und auf andere zu wirken. Im Guten wie im Schlechten.
Auch für Bane geht es beim Maske tragen um Atem und Versorgung mit Luft. Er braucht nach einer Veränderung seines Körpers aber auch Chemikalien, um weiter zu existieren. Für ihn wie für Vader und Sub-Zero ist die Maske lebenserhaltend und lebenswichtig. Dazu gibt sie ihm Kraft und macht anderen Angst.
Aber sie gibt ihm auch eine neue Persönlichkeit. Bane, Vader und Sub-Zero als Person gibt es nur mit Maske, sonst sind sie jemand anderes. Wie übrigens auch die media personas (engl.), die Scheinpersönlichkeiten im Internet, die es hinter der äußeren Fassade nicht weitergibt.
Eine Schicht mehr – Identität, Person, Trinität
Jetzt greife ich kurz in die etymologisch-theologische Mottenkiste. Persona kommt von personare, also durchatmen. Es wird auch auf das griechische proposon zurückgeführt, das Wort für Maske, Gesicht oder Angesicht, für die Rolle im Leben, die Amtsstellung oder gerade die Rolle im Theater. Die Person ist das Durchtönen von Schauspielenden durch seine Maske, bzw. durch seine Rolle hindurch – im Leben wie auf der Bühne, bzw. wurde beides nicht wirklich unterschieden.
In Gottes Drama, Gottes Stück, das er mit uns Menschen aufführt, kriegen auch wir Masken zugeordnet, in die wir reinwachsen und die wir ausfüllen lernen, hinter und in denen wir unsere Persönlichkeit entwickeln. So entwickelt das z.B. Hans-Urs von Balthasar. Sie ist der Ruf Gottes in ein Leben mit Christus, eine Rollenzuweisung, in der wir erst wir werden.
Noch weiter unten in der theologischen Kiste haben Tertullian und Boethius in der Entwicklung der Trinität das Wort persona verwendet als so etwas wie den Kern, die individuelle Substanz der Vernunft. Die Masken-Rolle macht aber zugleich deutlich, dass wir immer sind, als wer wir in Kontakt treten, in Relation kommen mit anderen. Deswegen hat der personale Gott auch eine Beziehung zu uns. Deswegen ist Gott nur Gott in dreieiniger Gemeinschaft und in Beziehung zu uns.
Gott wirkt in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist auf uns. Una substantia, tres personae. Ein gemeinsames Kernding, aber auch drei auffächerbare und erlebbare Masken-Rollen-Personen. Folgt man Richard Weihe (Die Paradoxie der Maske, München 2004), entlehnt Tertullian damit die Grundlage für die Trinität aus der Karthager Theaterwelt. Diese Kontaktfläche mit der Welt, die Personen-Maske hält Gott sich also vors eigentliche Gesicht. Damit ist auch Gott in der theatralisch bestimmten Trinität, wie die Helden und die mächtigen Bösewichter, maskiert und das dreimal. Aber nicht zur Abschreckung oder weil er anders nicht leben kann, sondern als Kontaktaufnahme. Ganz kommen wir nicht an ihn ran, da bleibt etwas Unnahbares, sich Entziehendes.
Aber der maskierte Gott ist das liebevoll und paradoxerweise gerade offen, denn die Maske, die schiere Notwendigkeit einer Maske zeigt doch eines an Gott und an uns: Sie zeigt wie verletzbar wir Dahinter sind. Wie angreifbar Menschlichkeit und Göttlichkeit hinter den Rollen und Schutzschichten und Kontaktflächen sind. Und nicht ohne sie können.
Mit unseren Masken teilen wir diese Erfahrung gerade besonders greifbar. Wir haben eine materiell-sichtbare Schicht mehr hinzugefügt: Zu unserem Gesicht, das selbst eine riskante Kontaktschicht ist, hinter der transzendent der Mensch, das Individuum, was auch immer wir als Kern haben – vielleicht gibt es den so unveränderlich aber auch gar nicht – sich verbirgt und pulsiert und fordert und liebt und durchatmet.
Die OP-Maske macht das ganz kaltblütig und direkt klar, pure funktionale Verletzlichkeit, das macht die Maske sichtbar. Die kreativen Do-it-yourself-Masken mischen mehr Menschlichkeit mit der Kontaktfläche, sie nehmen Kontakt auf, individualisieren.
Auf diese Weise macht das Maskentragen uns also doch, paradoxerweise, im Moment menschlicher. Die Rolle und das Gesicht, das wir sonst für das echte Ich halten, werden so durch eindeutig und nicht anders erkenntliche gleichmachende Außenflächen verdeckt und entlarvt. Die neue Schicht lässt uns eine seltsame Trinität der Krise am Kopf tragen: Außenschutz, Gesicht, Augen und Atem die durchblitzen und dahinter die Individualität, Bewusstsein, Transzendenz des Gegenübers.
Damit hat das Maskentragen auch eine theologische Dimension, die über die Defizienz hinausgeht, die es noch weiter zu erforschen und zu entwickeln gilt.
Chang-Hee Son (Haan of Minjung Theology and Han of Han Philosophy, Oxford 2000) schreibt über den koreanischen Haan-Maskentanz, dass sich in ihm Theologie zeigt, vielleicht wie in unserem Maskentragen im Gottesdienst wie im Laden. Wir machen das ja aus Liebe und Schutz und Angst, aus theologischen Kern-Beweggründen. Theologie ist dann der Umgang mit Gesichtern, von Körpersprache und der Semantiken des ganzheitlichen Wahrnehmens anderer. Der spielerische Umgang mit Masken ermöglicht, die Wirklichkeit zu wechseln und eine kritische Transzendenz zu entwickeln, als Schutz und aber eben gerade als Spiel. Wenn wir das also mehr ausbauen, die Maske als experimentelle Schicht, und tragbarer Gegenwartskommentar und weiter Kreativität zu Schutznotwendigkeit hinzufügen, können wir das Symbol für die Pandemie vielleicht auch für die Zeit danach verändern und verschönern.